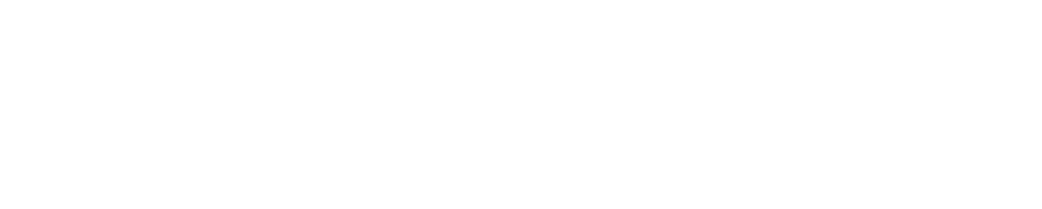In Brandenburg wurde schon im 17. Jh. verordnet, das nicht mehr wie 5 Paten zulässig sind und für die Überzähligen Gebühren anfallen. Um 1760 sieht man dann zumindest in einer Inspektion das Geld für die Überzähligen Paten an die Predigerwitwenkasse gezahlt wurde. Also könnte es doch auch gut sein, das in Hessen der Oberste festlegte die Gelder für die Hebammen zu nehmen, um deren Situation zu bessern. Das muß dann aber auch irgendwo festgehalten sein.
In preußischen Gebieten flossen diese Gebühren offenbar tatsächlich auch in Hebammeneinrichtungen:

www.digitale-sammlungen.de
Aber, ob die Kritik am
Eigeninteresse darauf abzielte? Vermutlich bezieht diese sich eher auf die Beträge, welche die Hebammen für jeden weiteren geworbenen Paten zusätzlich erhielten, indem sie von den Paten
beschenkt bzw. für die geleisteten Vermittlungsdienste (
Gevatterbitten, wie von vnagel2004 bereits erwähnt) vergütet wurden.
dass es ein Akt der Solidarität der Dorfjugend gewesen sein könnte, wenn eine von ihnen unehelich Mutter wurde, da dann mehrheitlich die jungen, ledigen Leute der Gemeinde Paten (oder Taufzeugen?) wurden.
Interessant fand ich in diesem Zusammenhang die Bemerkung, dass in einer Region in Unterfranken bei unehelichen Müttern nicht nur, von Haus aus und ganz offiziell, eine höhere Anzahl an Paten als gewöhnlich vorgesehen war (vier), sondern auch, dass diese, wohl im Rahmen der Armenfürsorge, sogar durch die Gemeinde "rekrutiert" wurden (linke Seite oben):
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb11828687?page=212,213&q=gemeinde+UND+gevattern. Das weist ebenfalls in die Richtung, dass die soziale Härte einer unehelichen Geburt in der Dorfgemeinschaft etwas abgepuffert werden sollte.
Insgesamt dürfte die vielstimmige Kritik der Kirche an einer gewissen "Kommerzialisierung" der Einrichtung Patenschaft nicht völlig aus der Luft gegriffen gewesen sein, insbesondere da es ja schon etwas schwer fällt, "Massenpaten" mit der eigentlichen Bestimmung und Aufgabe dieses Amts, für die religiöse Erziehung des Kindes zu
bürgen, in Einklang zu bringen. Abgesehen von explizitem Betrug, welcher auch vorgekommen sein soll (ganz witzige Story:
https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10335903?page=75&q=(betrug+UND+gevatterbitten)), erscheint es mir durchaus plausibel, dass es Fälle gab, bei denen das finanzielle Interesse (sei es auf Seiten der Gevatterbitter, sei es bei den Eltern/Müttern) eine gewisse Handlungstriebfeder war, wie diese Fundstellen auch noch mal belegen:

www.digitale-sammlungen.de

www.digitale-sammlungen.de

www.digitale-sammlungen.de
 www.archion.de
Das Kind ist laut Eintrag das 5te uneheliche Kind, der 2te Sohn dieser Frau. Es wird angegeben, dass der Vater der Mutter, also Großvater des Kindes nach Amerika ausgewandert ist.
www.archion.de
Das Kind ist laut Eintrag das 5te uneheliche Kind, der 2te Sohn dieser Frau. Es wird angegeben, dass der Vater der Mutter, also Großvater des Kindes nach Amerika ausgewandert ist.